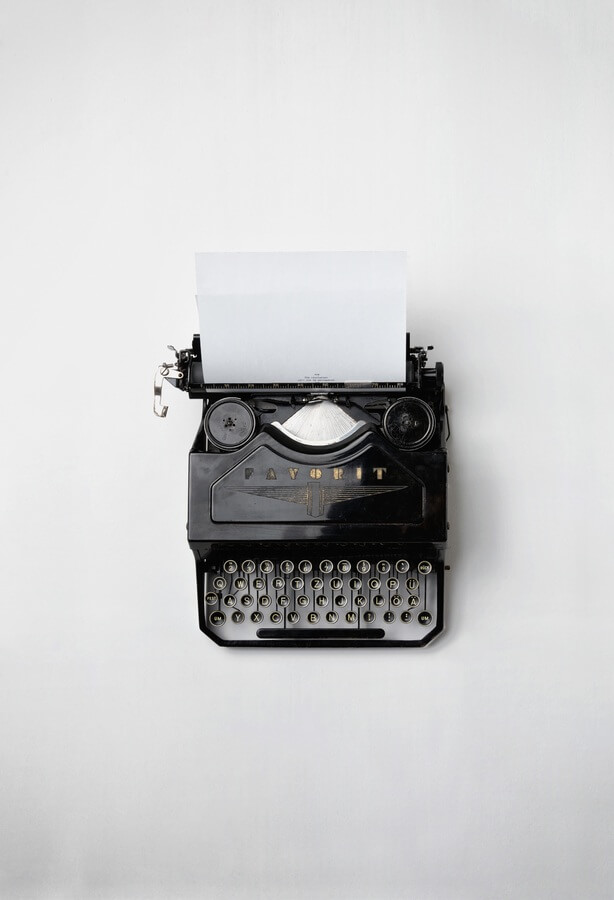Verlorene Jugend? – Wie Corona und die Lockdowns die Psyche einer Generation belastet haben
Die Corona-Pandemie hat weltweit Spuren hinterlassen – besonders schwer aber traf sie die Jugend. Während Erwachsene oft über Homeoffice, Wirtschaftshilfen oder Risikogruppen diskutierten, geriet eine ganze Generation still unter Druck. Die tiefgreifenden Einschnitte in das soziale, schulische und emotionale Leben haben bei vielen Jugendlichen bleibende Spuren in der psychischen Gesundheit hinterlassen.
- Isolation in der sensibelsten Entwicklungsphase
Die Pubertät ist eine Zeit der Identitätsbildung, der Ablösung vom Elternhaus und des sozialen Austauschs mit Gleichaltrigen. Genau diese Entwicklung wurde durch Schulschließungen, Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen massiv gestört.
Viele Jugendliche verbrachten Monate alleine oder ausschließlich im digitalen Raum.
Der Mangel an realen Freundschaften und sozialen Erlebnissen führte zu Gefühlen der Einsamkeit und Isolation.
Psychosoziale Entwicklungsschritte wurden verzögert oder blieben aus.
- Anstieg psychischer Erkrankungen
Studien zeigen deutlich: Die psychische Gesundheit Jugendlicher hat sich während der Pandemie stark verschlechtert.
Depressionen und Angststörungen nahmen dramatisch zu.
Essstörungen, besonders bei Mädchen, traten häufiger auf.
Suizidgedanken und -versuche stiegen in mehreren Ländern signifikant an.
Die Nachfrage nach Therapieplätzen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie schnellte in die Höhe – die Versorgung konnte kaum Schritt halten.
- Schule als Stressfaktor – nicht als Stabilität
Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch der Struktur, des sozialen Austauschs und der Orientierung. Während der Lockdowns wurde sie oft zur Quelle von Stress und Überforderung:
Digitaler Unterricht war oft unkoordiniert, ungleich verteilt und für viele unverständlich.
Leistungsdruck stieg – ohne Unterstützung durch Lehrer oder Mitschüler im Klassenzimmer.
Prüfungen und Zukunftsentscheidungen (z. B. Berufswahl, Studium) wurden zur zusätzlichen Belastung in ohnehin unsicheren Zeiten.
- Fehlende Lebensfreude und Perspektiven
Jugendliche brauchen Perspektiven – das Gefühl, dass das Leben vor ihnen liegt. Genau dieses Gefühl wurde durch die Pandemie oft zerstört:
Geplante Reisen, Konzerte, Abschlussfeiern, Partys oder Auslandsaufenthalte fielen aus.
Die ständige Unsicherheit über Regeln, Impfstatus, Infektionszahlen und Zukunftsaussichten machte Planungen unmöglich.
Viele Jugendliche fühlten sich übersehen, politisch ignoriert und als „nicht systemrelevant“ abgestempelt.
- Familiäre Konflikte und Überforderung
Durch die räumliche Enge und die emotionale Anspannung stieg auch die Konfliktrate in vielen Familien:
Jugendliche waren teils wochenlang mit überforderten Eltern eingesperrt – ohne Rückzugsort.
Häusliche Gewalt nahm zu, viele Jugendliche hatten keine Möglichkeit, sich Hilfe zu holen.
Die emotionale Distanz zwischen Eltern und Kindern wuchs in manchen Haushalten.
Fazit:
Die psychischen Folgen der Corona-Pandemie für Jugendliche sind nicht nur ein kurzfristiges Phänomen – sie wirken oft bis heute nach. Viele junge Menschen tragen emotionale Narben aus dieser Zeit, die sich nicht einfach mit dem Ende der Pandemie auflösen. Es braucht mehr als nur den Rückkehr zur „Normalität“: Es braucht gezielte Hilfsangebote, offene Gespräche, psychologische Unterstützung – und endlich mehr Aufmerksamkeit für die Generation, die in der Krise am wenigsten gefragt, aber am meisten belastet wurde.