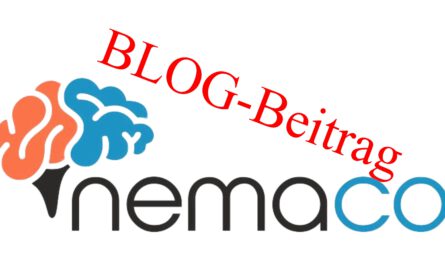Meine Tochter, 8 Jahre alt, hatte sich gestern mit einer Freundin verabredet. Sie kam vollkommen traurig wieder nach Hause und bat darum, sie daran zu erinnern, nicht mehr zu dieser Freundin zu gehen. Hintergrund ist, dass sie sich total gelangweilt hatte. Eine andere Freundin kam zu Besuch und beide haben ein eigenes Handy, mit dem sie sich dann befassten. Meine Tochter war nun „nicht mehr da“. Meine Tochter fühlte sich überflüssig und sehr unwohl. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, warum wir unserer Tochter noch kein Smartphone geben. Der Grund dafür, lesen Sie selbst:
Es ist immer mehr zu beobachten, wie sehr das Smartphone zum Lebensmittelpunkt der meisten Menschen geworden ist. Auf Grund der damit verbundenen unfassbaren Möglichkeiten, sie beinahe niemand, welche Auswirkungen die von der prosperierenden Telekommunikationsbranche vorangetriebene Entwicklung auf die Kinder hat.
Es gibt die ersten deutlichen Warnungen von Kinderärzten im Hinblick auf den Smartphone Gebrauch von Eltern, welches das Bindungs- und Spielverhalten von kleinen Kindern beeinflusst. Diese Bindungs- und Spielverhalten von kleinen Kindern bilden die Grundlage für psychische Gesundheit und emotionale, soziale und kognitive Bildung. Die einschneidende Störung hat Folgen für die weitere Entwicklung. Insbesondere aber ist darauf zu achten, dass Kinder nicht zu früh an die Medienwelt herangeführt werden. Ein Smartphone sollte nicht an Kinder unter 10 Jahren gegeben werden. Kinder bis zum 10. Lebensjahr benötigen Bewegung und die Umwelt- sowie Umfeld Einflüsse um sich psychosozial gesund zu entwickeln. Viele Eltern nutzen die Gelegenheit, die Kinder vor ein Smartphone/Tablet zu setzen, um sich vom beschwerlichen Alltag zu erholen. Doch viele Eltern sollten die aktive Erholung anwenden. Kinder benötigen für ihre Entwicklung die Bewegung und das BeGREIFEN. Somit ist es sehr wichtig, dass Kinder sich in der freien Natur bewegen können. Bei schlechtem Wetter ist ein Gesellschaftsspiel mit der Familie förderlich. Kinder müssen sich mit der realen Welt befassen, damit sie Sozialkompetenz und Konfliktlösungsmöglichkeiten entwickeln.
Experten raten dringend, die Gewohnheiten im Umgang mit digitalen Medien im Sinne eines guten Aufwachsens der Kinder so weit wie möglich umzustellen. So stellt sich die Frage, wie eine solche Umstellung zu bewerkstelligen ist bei Beachtung der Bedürfnisse aller Beteiligten. Zu Beginn der Entwicklung eines Kindes müssen natürlich die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt stehen. Dazu ist es hilfreich, diese Bedürfnisse genauer zu betrachten!
Warum sollten Eltern ihr Smartphone selbst ebenfalls aus der Hand legen:
Damit Kinder in den ersten zwei Jahren eine sichere Bindung zur primären Bezugsperson aufbauen können, benötigen sie die ungestörte Aufmerksamkeit, den feinfühligen Umgang und die weitgehende Anwesenheit dieser Person. Ist die Aufmerksamkeit der Bezugsperson immer wieder abgezogen durch die vollkommene Konzentration auf ein digitales Medium, reagieren die meisten Kinder verstört darauf. Machen die Kinder eine solche Erfahrung von Anfang sehr häufig, reagieren sie zwar irgendwann nicht mehr, ihre Bindungsbemühungen gehen jedoch zurück und auch ihr Spielverhalten lässt nach; denn das für das Spielen notwendige Sicherheitsgefühl kann sich nicht einstellen.
Wenn die Eltern jedoch dazu übergehen, ihrem kleinen Kind das hoch interessante Ding zum Spielen zu überlassen, ist es ruhig und zufrieden. Passiert das häufig und langzeitig, wird das Kind in seiner Entwicklung in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt. Die biologisch angelegten Lernprozesse werden gestört, die kognitive und soziale Entwicklung ist eingeschränkt. Des Weiteren besteht die Gefahr, später Suchtverhalten zu entwickeln. In welcher Form diese Einschränkungen in der Entwicklung entstehen, soll im Folgenden erläutert werden.
Störungen des Lernprozesses
Bei kleinen Kindern wird Lernen ausschließlich über die Bewegung und das sensorische Empfinden in Gang gesetzt. Die ersten zwei Jahre werden deshalb auch als senso-motorische Phase bezeichnet (Piaget 1992). Darüber werden die Milliarden Gehirnzellen und die einzelnen Bereiche im Gehirn nach und nach miteinander verknüpft, so dass in der Folge gegen Ende des zweiten Lebensjahres Denken möglich ist. Vorher ist Denken und Handeln dasselbe. Wird die Bewegungslust durch ein solch faszinierendes Spielzeug nicht mehr empfunden, kommen die biologisch verankerten Antriebe des Erkundens, der Wissbegierde, der Nachahmung, des Spielens und des schöpferischen Erfindens nicht oder zu wenig zum Einsatz. Der Übergang vom Handeln zum Denken kann sich nicht störungsfrei entwickeln, so dass es zu Entwicklungsverzögerungen kommt.
In der Regel zeigt sich dieser Übergang am Selbsterkennen mit ca. 2 Jahren, wenn das Kind ICH zu sich selbst sagt.
Mit den ständigen Bewegungen dieser Phase und den damit einhergehenden sensorischen Erfahrungen erfährt das Kind die dingliche Welt und die räumliche Realität. Das führt zur Ansammlung von Wissen, das seine Intelligenz ausbildet und rapide vorantreibt.
Das kann vor Bildschirmen nicht geschehen. Das Kind erlebt nur eine Abstraktion der dinglichen Welt, die es bis ins Grundschulalter hinein nicht verarbeiten kann. Denn was es sieht, ist flächig; man kann es nicht anfassen, nicht schmecken, nicht riechen, nicht ertasten. Das Kind kann also keine für das Denken so wichtigen konkreten sinnlichen Erfahrungen machen, wenn es häufig und langzeitig mit digitalen Medien befasst ist.
Die Bewegung spielt bis weit ins Grundschulalter, bis ins 10. Lebensjahr, hinein eine wesentliche Rolle für die gesamte Entwicklung, denn sie ist auch die Grundlage für das Körperempfinden und damit für das Selbstwirksamkeitsempfinden. Besonders in den ersten Jahren entwickelt das Kind über die Erfahrung, die es mit seinem Körper macht, ein Bild von seinen eigenen Fähigkeiten, d.h. was es kann oder was nicht gelingt, also von seiner Leistungsfähigkeit insgesamt. Dies ist eine wichtige Grundlage für ein positives Selbstwertgefühl.
Auch die Feinmotorik bewirkt die Ausbildung von speziellen Strukturen im Stirnhirn; deshalb ist zuerst das feinmotorische Erkunden der Umwelt und später das Malen, und in der Grundschule das Schreiben mit der Hand so wichtig. Wird dies durch das ausschließliche Antippen von Tasten oder dauerndes Wischen ersetzt, bleiben diese Strukturen unterentwickelt. Bei hohem Nutzungsverhalten werden lt. Studien die Hirnbereiche, die mit Sprache und dem Erlernen von Schreiben und Lesen verbunden sind, weniger strukturiert, d.h. die Dichte der Neuronen ist geringer. Ebenso stellten die Forscher eine geringere Myelinisierung in diesen Bereichen fest. Myelin, eine weiße Substanz, sorgt für eine schnelle Verarbeitung von Signalen. Das bedeutet, bei schadhafter oder geringerer Myelinisierung wird das Denken langsamer.
Die digitalen Medien passen also in den so wichtigen senso-motorischen Entwicklungsrahmen der ersten Jahre nicht hinein. Gibt es durch eine häufige Nutzung digitaler Medien zu viele Störungen, führt das zur Einschränkung in der gesamten Entwicklung. Zusätzlich besteht die Gefahr, bereits im Vorschulalter Suchtverhalten zu entwickeln.
Gefahr von Suchtverhalten
Im Gehirn löst das digitale Feuerwerk schneller Videos und bunter Animationen ein Reizbombardement aus, das auf das Stammhirn (unteres limbisches System) niedergeht (Lembke & Leipner 2015). Es trifft in erster Linie das Belohnungssystem, das bei kleinen Kinder durch einen häufigen Gebrauch digitaler Medien völlig überdreht. Bestimmte Module reifen dann zu schnell und unzulänglich (Teuchert-Noodt 2016). Wichtige Teilbereiche des Stirnhirns können sich nicht voll entfalten. Bei Klein- und Grundschul-Kindern ist das Stirnhirn noch nicht so weit ausgebildet, dass es die notwendige Kontrolle über Belohnungsreize ausüben kann! Das führt sehr bald zu Suchtverhalten; denn besonders die kleinen Kinder verlangen ständig und völlig außer sich nach dem digitalen Spielzeug, sind nicht einsichtig für Erklärungen und interessieren sich nicht mehr für konkrete Spielangebote.
Um diese Suchtgefahr zu verstehen, hilft das Wissen über den Ablauf des normalen Lernprozesses, der zur Speicherung des Wahrgenommenen im Langzeitgedächtnis führt. Dazu muss der Lernstoff immer an vorhandenes Wissen anknüpfen können, der Ort wird gespeichert, in dem der Lernakt stattfindet sowie das in dem Moment empfundene Gefühl. Ist das Wissen neu und interessant, verursacht es ein positives Gefühl. Dann schüttet das Belohnungszentrum Dopamin oder Serotonin aus und das Kind ist motiviert, weiter zu machen, um das gute Gefühl wieder zu erleben. Es bleibt also aktiv und lernt. Nach einer solchen längerfristigen Kombination ist das Wissen dann später auch als Erinnerung abrufbar. Der Weg läuft über den Hippocampus, einer zentrale Schaltstation des limbischen Systems. Der Hippocampus arbeitet langsam, er hat andere Nervenzellen und sorgt damit für die Langzeitspeicherung des neuen Wissens.
Der digitale Sinnesreiz schießt sich jedoch auf verkürztem Weg direkt ins Belohnungszentrum des limbischen Systems (Ausschüttung von Dopamin) und trickst den zum Lernen notwendigen Weg über den Hippocampus und den Gedächtnisspeicher im Großhirn aus. Die neuronale Verarbeitung von Lerninhalten verkürzt sich, die Verbindungen im Gehirn kommen nicht zustande, so dass eine solide Langzeitspeicherung unmöglich wird.
Wenn kleine Kinder das Smartphone der Eltern zur Ruhigstellung bekommen, wirkt dieses Feuerwerk besonders stark. Die ganz Kleinen sind durch ihre biologisch verankerte Funktionslust vorerst nur an der Wischbewegung interessiert. Sie nehmen die kleinen schnellen Bilder noch nicht richtig wahr. Sobald das der Fall ist, trifft sie das digitale Feuerwerk direkt, so dass bei häufigem Spielen damit langfristige Folgen nicht ausgeschlossen sind.
Die Einschränkungen in der Entwicklung durch den Suchtfaktor werden verstärkt durch die Tatsache, dass wir Menschen (Männer mehr als Frauen) immer neugierig auf Dinge sind, die sich bewegen. Ein Tablet oder Smartphone mit bewegten Bildern zieht kleine Kinder so heftig an, dass Ritterburgen und Spielfiguren an Attraktivität verlieren. Denn da muss das Kind jede Figur bewegen, sich im Kopf eine Handlung ausdenken, während auf digitalen Medien alles automatisch abläuft. Es gibt kein Training im Denken wie beim selbst gesteuerten Spiel. Das Kind muss auch keine Willenskraft aufwenden, um etwas zu erreichen. Dann spürt es auch die positiven Gefühle über das Erreichte nicht, so dass seine natürliche Leistungsbereitschaft zurück geht. Seine Konzentrationsfähigkeit wird nicht geübt, was im Hinblick auf die spätere Schulfähigkeit kritisch ist.
Störungen der sozialen Entwicklung und der Selbstkontrolle
Neben den Störungen der kognitiven Entwicklung und dem Suchtpotenzial greift der frühe und häufige Umgang mit der Bilderwelt der digitalen Medien in den Bereich der sozialen Entwicklung und der Selbstkontrole ein.
Das soziale Denken und Verstehen ist in der Vorschulzeit erst im Aufbau, so dass Störungen von außen langfristige Folgen haben können. Dieser Aufbau verläuft über vorgegebene Reifungsschritte, die an folgenden Merkmalen zu erkennen sind:
In den ersten zwei Jahren läuft das soziale Handeln nur über die Gefühlsansteckung. Erst zwischen 2 und 3 Jahren kommt die Kognition dazu. Es ist die Zeit, wo sich das ichbezogene Denken aufgliedert und die Kinder mühsam lernen, sich in den anderen hinein zu versetzen. Das Denken ist am Anfang total ichbezogen und die Gefühlsansteckung hilft dem Kind, hin und wieder doch sozial zu handeln. Mit ca. 3 Jahren wird die Gefühlsansteckung durch das beginnende soziale Denken und Verstehen ergänzt. Dann wird das Spiel mit anderen Kindern besonders wichtig, weil das soziale Lernen am Beginn über das bewusste gemeinsame Spiel in Gang kommt: Beim Rollenspiel schlüpfen die Kinder in verschiedene Rollen und üben dabei unbewusst, sich in die andere Rolle hinein zu versetzen. So sind sie immer aktiv, laufen und springen herum, bewegen Spielsachen und reden ununterbrochen. Das ist die natürliche Form des sozialen Lernens, die bei allen Kinder auf der Welt von ganz allein funktioniert. Auch die sprachliche und die kognitive Entwicklung wird durch diese Spiele vorangetrieben. Das soziale Lernen im Spiel passiert unbewusst. Den Kindern ist anfangs nur bewusst, dass sie spielen, aber sie reflektieren den Inhalt des Spiels nicht, sondern handeln spontan. Das trainiert den Kopf und ist der Vorlauf zum Bewusstwerden der sozialen Interaktion im Spiel. Über das unbewusst gesteuerte Handeln wird mit der Zeit begriffen, um was es genau geht. Erst danach wird es bewusst, man kann darüber nachdenken und sprechen. Kinder können bis ins Grundschulalter hinein (besonders Jungen) häufig nicht über soziale Situationen reden. Erst ab sechs Jahren gelingt das den meisten Kindern. Sie verhalten sich dann von sich aus sozial (sie teilen dann z.B, weil sie die Bedürfnisse des anderen verstehen können) und sind oft erstaunt über ihre sozialen Gefühle (sie berichten nachdenklich darüber, also nicht loberheischend wie vorher).
Die Selbstkontrolle als wichtiger Aspekt des sozialen Lernens ist ebenso auf die direkte Gruppeninteraktion angewiesen. Diese wichtige Fähigkeit wird in der Vorschulzeit ab dem 4. Lebensjahr möglich, wenn die Kinder immer wieder beim gemeinsamen Spielen, Singen und Basteln lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen, sich also selbst zu kontrollieren. Diese Entwicklung dauert mehr als drei Jahre. Sie muss auch noch im Grundschulalter immer wieder durch das gemeinsame Spiel trainiert werden, um sich zu stabilisieren.
Digitale Medien in der Kita?
Für die Kinder ist der geschilderte schwierige soziale Lernprozess kein Problem, wenn sie ihrem spontanen Spieltrieb nachgehen können. Deshalb sollten nur notwendige Unterbrechungen im Tagesablauf das Spiel beenden. Bildungseinheiten mit digitalen Medien gehören nicht zu den Notwendigkeiten. Sie beschleunigen weder den sozialen noch den kognitiven Lernprozess, sondern stören Lernprozesse nachhaltig. Alle hier beschriebenen wichtigen Lernprozesse können nicht ohne Einschränkungen stattfinden, wenn Kinder sich schon früh und langzeitig mit digitalen Medien beschäftigen.
Was bedeutet das für den Einsatz in Kitas? Es gibt keinen den Kindern nutzenden Grund, in der Kita digitalen Medien einzusetzen. Auch die als „Haus der kleinen Forscher“ hervorgehobenen, mit digitalen Medien arbeitenden Kitas mit ihren begrenzten Medienzeiten ziehen diese von den entwicklungsfördernden Aktivitäten der Kinder ab. Hinzu kommt, dass Aktionen mit digitalen Medien die meisten Kinder faszinieren, so dass sie davon ferngehalten werden müssten. Des weiteren kann von Vorschulkindern noch kein realistisches Verständnis für ihre Umwelt erwartet werden. Bis ins sechste Lebensjahr hinein ist die logische Denkweise noch nicht voll ausgebildet (Piaget 1984, S. 157f.). Die Vorschulkinder sind dementsprechend neurobiologisch noch gar nicht in der Lage, Medienkompetenz zu entwickeln. Dies wurde auf dem Kongress des DIJ am 28.01.2016 in München, „Tablets in Kinderhand“, auch sehr eindrucksvoll mit einer Studie zur Medienaneignung Zwei- bis Sechsjähriger bestätigt. Die Kinder unter 6 Jahren konnten mit den digital dargestellten Situationen nichts anfangen; sie suchten fortwährend nach wirklichen Objekten.
Die Befürchtung mancher Erziehenden, dass die Kinder den Anschluss an das digitale Zeitalter verlieren, wenn sie nicht früh den Umgang mit digitalen Medien lernen, ist unbegründet. Die Kinder lernen dies sehr schnell, wenn ihr Gehirn weit genug ausgereift ist. Das ist frühestens zum Ende des Grundschulalters der Fall. Deshalb empfehlen alle wirtschaftsunabhängigen Experten, Kindern erst mit 12 Jahren digitale Medien selbstverantwortlich zu überlassen. Bei zu frühem und langzeitigem Medienkonsum besteht die Gefahr, dass die Schlüsselqualifikationen, die für die Beherrschung der digitalen Medien gebraucht werden, sich nicht entwickeln können (Teuchert-Noodt 2017).
Das bedeutet, in Kitas sollten keine digitalen Medien eingesetzt werden. Da sich derzeit die ganze Gesellschaft in einem Rausch der digitalen Möglichkeiten befindet, ist es jedoch schwer, die Kinder davor zu schützen. Kitas können zwar digitale Medien verbannen, es bleibt jedoch der starke Einfluss durch die Eltern. Hier könnten ErzieherInnen einen Elternabend nutzen, um die Problematik zu vermitteln. Eltern müssten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Wenn sie selbst ständig das Smartphone in der Hand haben, können sie dies den Kindern nicht ausreden. Dann sind sie unglaubwürdig und die Kinder lernen, dass das Smartphone einen besonderen Wert hat. Es gibt inzwischen viele kleinere Studien zum Thema, wie Eltern damit umgehen könnten. Bei drei dieser Studien kam heraus, dass über das gemeinsame Hantieren mit digitalen Medien die Kontrolle der Eltern am besten funktioniert (Festl & Langmeyer 2018). Das bedeutet, Eltern sollten immer nur kurz dem Kind auf dem digitalen Medium etwas zeigen; das Gerät jedoch nicht aus der Hand geben. Es bleibt dabei wichtig, im Alltag das begehrte Objekt aus dem Blickfeld der Kinder zu nehmen.
Durch eine Zusammenarbeit mit den Eltern könnten Erzieherinnen erreichen, die Kinder vor schädigendem Einfluss digitaler Medien zu schützen.
Literatur & Herkunftsnachweise
Festl, R. & Langmeyer, A. (2018): Die Bedeutung der elterlichen Interneterziehung für die Internetnutzung von Vor-, Grund- und Sekundarschulkindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie Heft 2, S. 154-180.
Lembke, G. & Leipner, I. (2015): Die Lüge von der digitialen Bildung. Warum unsere Kinder das Lernen verlernen. Redline-Verlag, München.
Piaget, J. (1984): Psychologie der Intelligenz. 8. Aufl., Klett-Cotta, Stuttgart.
Piaget, J. (1992): Das Erwachen der Intelligenz beim Kind. DTV, München.
Teuchert-Noodt, G. (2016): Ein Bauherr beginnt auch nicht mit dem Dach. Die digitale Revolution verbaut unseren Kindern die Zukunft. Umwelt-Medinzin-Gesellschaft, 29, Heft 4..
Teuchert-Noodt, G. (2017): 20 Thesen zu digitalen Medien aus der Sicht der Hirnforschung. Umwelt-Medizin-Gesellschaft 30, Heft 4.
Dr. Erika Butzmann: Fachbeitrag „Das Portal für Frühpädagogik“ ErzieherIn.de
Bad Oeynhausen, den 06.09.2023 Mike Grohmann